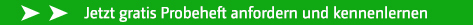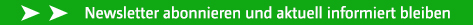Auszug aus Heft 1/21
Zuversicht macht stark, denn optimistische Menschen sehen in jeder Lebenskrise auch eine Chance. Und die Pessimisten? Für die hat die Hirnforschung gute Nachrichten: Optimismus lässt sich lernen!
Bis ins Detail war alles arrangiert. Ein rauschendes Fest sollte es werden. Unvergesslich schön! Doch Corona machte dem Paar einen Strich durch die geplante Hochzeitsfeier im Mai. Das könne nur ihr passieren, seufzte die Braut – hätten sie mal besser schon im Spätherbst geheiratet! Am Tag der standesamtlichen Trauung war sie so verzagt, dass sie das Ereignis gar nicht genießen konnte, die Feier hatte sie auf unbestimmte Zeit verschoben. Ein anderes Brautpaar, denen Gleiches widerfuhr, war zunächst auch niedergeschlagen. Doch schon zwei Tage später hatte das Paar einen neuen Plan geschmiedet: Im Sommer würden sie im Garten eines Freundes ein großes Fest machen. Das sei eh viel schöner als drinnen zu feiern, meinte die Braut zuversichtlich. Während die erste Braut resigniert auf die Feier verzichtet und sich sogar selbst die Schuld gibt, lässt die zweite Braut sich nicht entmutigen. Sie gewinnt dem Problem sogar eine positive Seite ab.
Wie unterschiedlich Optimisten und Pessimisten mit ein und derselben Situation umgehen, zeigt dieses Beispiel. Was uns unglücklich macht, ist nicht unbedingt das Geschehen selbst, sondern wie wir es gefühlsmäßig bewerten. Nur selten ist eine Situation ganz und gar hoffnungslos. Aber wir nehmen nun einmal nur Bruchstücke und nicht die gesamte Realität wahr.
Optimismus macht erfolgreich
Im Prinzip gebe es keine Krise, sondern nur Krisenerleben, konstatiert Sebastian Mauritz, Gründer und Trainer der Göttinger Resilienz Akademie, nüchtern. Wer sich düstere Gedanken macht, verliert selbst dann die Hoffnung, wenn seine Lage gar nicht katastrophal ist – im Gegensatz zum Optimisten, der selbst in einer schwierigen Lage unverdrossen und engagiert nach Problemlösungen sucht. Er ist sich gewiss, dass es einen Ausweg gibt, deshalb hält er Belastungen lange stand. Darum ist eine positiv eingestellte Person tatsächlich meist erfolgreicher als eine pessimistische.
Warum sind wir dann nicht alle Optimisten? Der Grund: Schwarzmaler ernten zwar weniger Früchte, dafür erhalten sie die Bestätigung, dass sie mit ihrer pessimistischen Vorhersage ja goldrichtig gelegen haben. Self Fullfilling Prophecy nannte der US-Amerikaner Robert K. Merton diesen Mechanismus. Schon 1948 hatte der Soziologe in einem Artikel dargestellt, wie Menschen in einen fatalen Kreislauf geraten können, wenn sie sich darauf versteifen, Situationen grundsätzlich negativ zu bewerten. Ein klassisches Beispiel ist die Ehefrau, die mit ihrer Eifersucht den Ehemann tatsächlich in die Arme einer anderen treibt und daraufhin erklärt, dass sie es ja immer geahnt habe. Oder der unsichere Jobbewerber, der überzeugt ist, dass er, obwohl gut qualifiziert, den Job bestimmt nicht kriegen werde. Im Zweifel bekommt er Recht – aber leider nicht die Stelle.
Zu Optimisten werden wir früh im Leben
Ob wir zu Optimisten oder zu Pessimisten heranwachsen, hängt stark von den vorgelebten Haltungen der Eltern ab. Sind diese schnell besorgt und sehen stets Probleme am Horizont aufziehen, übernehmen ihre Kinder diese negative Einstellung. Machen sie dann tatsächlich öfter schlechte Erfahrungen, verfestigen sich im Frontalhirn die negativen Emotionen. So ein Gefühlsmuster ist eigentlich sinnvoll, denn es wird bei möglicher Gefahr sofort aktiviert und hat eine wichtige Schutzfunktion. Das Problem: Selbst weniger belastende Erlebnisse lösen fortan eine Reaktionskette aus, die zur Ausschüttung von Stresshormonen führt.
Ermutigen hingegen Mutter, Vater oder auch die Großeltern ihre Kleinen darin, etwas auszuprobieren, und haben diese dann sogar Erfolg, bahnt sich das positive Erlebnis im Gehirn – im Mandelkern (Amygdala) und im cingulären Kortex – seinen Weg. Werden diese synaptischen Verbindungen aufgrund weiterer guter Erfahrungen öfter genutzt, entsteht nach und nach ein robustes positives Erlebnisnetzwerk, das sie später auch als Erwachsene gelassener durch Krisenzeiten gehen lässt. Sie können ihre Emotionen weitaus besser steuern und zeigen seltener Stressreaktionen.
Als Optimisten leben wir deshalb gesünder. Viele Studien, darunter eine jüngere Untersuchung der Universität Maastricht, an der es einen neueren Lehrstuhl für Gesundheitspsychologie gibt, belegen dies. Während in jungen Jahren Pessimisten und Optimisten noch gleich gesund sind, haben Optimisten ab dem 45. Lebensjahr seltener Herz-Kreislauf-Erkrankungen, einen niedrigeren Blutdruck, ein besseres Immunsystem und erkranken seltener an Depressionen als Pessimisten. Da sie zuversichtlich in die Zukunft schauen, haben sie nicht nur gesündere Gewohnheiten, sie verhalten sich auch nach Operationen oder Verletzungen vernünftiger.
Doch genügt es beileibe nicht, nur gute Laune zu haben oder nach dem Motto, „das wird schon wieder“ blind darauf zu vertrauen, dass es das Schicksal schon gut mit uns meine. „Um Krisen gut zu meistern, müssen Menschen sich immer wieder selbst als kompetent erleben und erfahren, dass ihre eigene Handlung oder ihr Vorgehen auch Wirkung zeigt“, erklärt die Diplom-Psychologin Dr. Daniela Blickhan, die nahe Rosenheim das Inntal Institut leitet und dem deutschsprachigen Dachverband für Positive Psychologie vorsteht. Neben Optimismus ist die Erfahrung von Selbstwirksamkeit einer der wichtigsten Faktoren, um eine Krise gut zu bewältigen. Sie macht unsere Seele widerstandsfähiger, resilienter, wie Psychologen sagen. Resiliente Menschen stehen nach einem Tiefschlag nicht nur schneller wieder auf, sie erkennen auch ihre Schwächen und Stärken klarer als Pessimisten, und auf die Stärken setzen sie.
Den vollständigen Beitrag finden Sie in Ausgabe 1/2021
Weitere Aspekte in diesem Beitrag:
- Stärker als die Widrigkeiten
- Optimistisch denken und fühlen lernen
- Üben Sie sich in Zuversicht!